News / Die Wiederholung macht die Fake News glaubwürdig
15.11.2023
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland
Die Wiederholung macht die Fake News glaubwürdig
Journalismus als Gateadvisor, der auch Nachrichten anderer beobachtet, prüft und verifiziert? Ein Bericht von einer Kooperationsveranstaltung von DPRG und FPC zum Zeitalter der Desinformation.
Die Aufgaben des Journalismus haben sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich geändert. Früher kam ihm die Rolle des Gatekeepers zu, der für die Konsumenten die Nachrichten aussucht. Mit dem Aufkommen der vernetzten Massenmedien kam die Aufgabe des Gatewatching dazu, bei dem das Zusammenstellen, Einordnen und Kuratieren von Quellen und Informationen zu bestimmten Themen im Mittelpunkt steht.
Nun hat nach Auffassung von Professor Ralf Hohlfeld eine neue Epoche begonnen, in der der Journalismus sich als Gateadvisor entwickeln muss, der auch Nachrichten anderer beobachtet, prüft und verifiziert. Eine ähnliche Entwicklung müsse auch die PR nehmen, formulierte Hohlfeld. Sein Gesprächspartner auf der gemeinsamen Veranstaltung von DPRG und des Frankfurter Presseclubs (FPC), der Fachjournalist Helmut van Rinsum, pflichtete ihm bei. Auch für den Ruf von Agenturen sei es von großer Bedeutung, dass sie verlässliche Gesprächspartner seinen, die sich auf der Basis von abgesicherten Fakten bewegten.
Was Moderator Matthias Dezes sofort bekräftigte: „Dieser Vortrag ist für uns Warnung und Ansporn zugleich: Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Aber wir haben eine Chance: Noch nie waren PR-Leute und Journalisten so gut ausgebildet, noch nie hatten wir so umfangreiche technische Möglichkeiten, dagegenzuhalten. Seien wir zuversichtlich!“
Das Ökosystem der Information funktioniert nicht mehr
In seinem Impulsvortrag hatte Hohlfeld analysiert, dass das Ökosystem der Information nicht mehr funktioniere. Gründe dafür sah er im Anstieg der Komplexität des alltäglichen Lebens bei abnehmender Fähigkeit der Bevölkerung, diese Komplexität zu bewältigen. Eine Unterhöhlung der Demokratie sah er darin, dass in Teilen der Bevölkerung Fakten nicht mehr als Basis einer Verständigung anerkannt, sondern Lügen und sogenannte alternative Fakten als gleichwertig angesehen würden. Prüfen auf Faktenebene werde nicht mehr anerkannt. Mit dieser Strategie legten die Antidemokraten ein Schleifwerkzeug an den demokratischen Diskurs an.
Als einen weiteren Aspekt führte er an die größere Bedeutung von Gefühlen anstelle von Argumenten in den sozialen Medien. Für den Journalismus formulierte Hohlfeld die Aufgabe, nicht ungewichtet jeder Perspektive Geltung zu verschaffen. Wenn jemand behaupte, die Erde sei eine Scheibe, dann dürfe die Überschrift eben nicht lauten: Diskussion über die Form der Erde.
Aus seiner Forschungsarbeit berichtete Hohlfeld über den Zusammenhang von Nachrichten und das Vertrauen in deren Wahrheitsgehalt. Je häufiger Medienkonsumenten eine Information wahrgenommen hätten, desto mehr glaubten sie an deren Wahrheitsgehalt. Gehen also Fake News viral, wächst ihre Glaubwürdigkeit. Hier gelte das alte Sprichwort: Steter Tropfen höhlt den Stein. Auf die Frage von Moderatorin Nina Mülhens, wie sich der Journalismus ändern müsse, formulierte van Rinsum das zeitökonomische Problem, dass dieser inzwischen auch alle Kommunikationskanäle bedienen müsse. Bei dem Druck, in die Breite zu gehen, bleibe dann manchmal die Recherche in die Tiefe auf der Strecke.
So transparent wie möglich arbeiten
Als ein mögliches Geschäftsmodell in näherer Zukunft sah er an, die Überprüfung von Fakten darauf spezialisierten Agenturen zu übergeben. Als Handlungsempfehlung für das schwieriger gewordenen Umfeld gab Hohlfeld den Gästen, so transparent wie möglich zu arbeiten. Sowohl für die PR als auch für den Journalismus sei die Einordnung von Fakten von großer Bedeutung, damit die Menschen eine Orientierung hätten. „Bislang haben wir gesagt: Nachrichten sind Commodity, Kommentar und Einordnung sind journalistischer Value. Heute brauchen wir drei: Commodity ist alles, was durchs Web schwirrt, Value sind verifizierte Informationen, aufbereitet von Profis, Kommentar und Einordnung sind Double Value“, merkte Matthias Dezes abschließend an.
Für die meisten Gäste ging das Podiumsgespräch viel zu schnell zu Ende, aber es gab anschließend bei einem Umtrunk auf Einladung der DPRG noch die Möglichkeit, die vielen Themen des Abends zu vertiefen. Bemerkenswert hoch war die Anwesenheit: 38 Gäste waren gekommen, gut 40 hatten sich angemeldet. In den sozialen Medien, vor allem auf LinkedIn, fand die Veranstaltung im Nachhinein große Resonanz.
Wer die Veranstaltung verpasst hat oder sie noch einmal ansehen will, kann dies auf dem Youtube-Kanal des Frankfurter Presseclub tun.
Foto v.l.n.r.: Nina Mühlens (FPC), Hemut van Rinsum, Prof. Ralf Hohlfeld, Matthias Dezes (DPRG)
Nun hat nach Auffassung von Professor Ralf Hohlfeld eine neue Epoche begonnen, in der der Journalismus sich als Gateadvisor entwickeln muss, der auch Nachrichten anderer beobachtet, prüft und verifiziert. Eine ähnliche Entwicklung müsse auch die PR nehmen, formulierte Hohlfeld. Sein Gesprächspartner auf der gemeinsamen Veranstaltung von DPRG und des Frankfurter Presseclubs (FPC), der Fachjournalist Helmut van Rinsum, pflichtete ihm bei. Auch für den Ruf von Agenturen sei es von großer Bedeutung, dass sie verlässliche Gesprächspartner seinen, die sich auf der Basis von abgesicherten Fakten bewegten.
Was Moderator Matthias Dezes sofort bekräftigte: „Dieser Vortrag ist für uns Warnung und Ansporn zugleich: Wir wissen, was auf dem Spiel steht. Aber wir haben eine Chance: Noch nie waren PR-Leute und Journalisten so gut ausgebildet, noch nie hatten wir so umfangreiche technische Möglichkeiten, dagegenzuhalten. Seien wir zuversichtlich!“
Das Ökosystem der Information funktioniert nicht mehr
In seinem Impulsvortrag hatte Hohlfeld analysiert, dass das Ökosystem der Information nicht mehr funktioniere. Gründe dafür sah er im Anstieg der Komplexität des alltäglichen Lebens bei abnehmender Fähigkeit der Bevölkerung, diese Komplexität zu bewältigen. Eine Unterhöhlung der Demokratie sah er darin, dass in Teilen der Bevölkerung Fakten nicht mehr als Basis einer Verständigung anerkannt, sondern Lügen und sogenannte alternative Fakten als gleichwertig angesehen würden. Prüfen auf Faktenebene werde nicht mehr anerkannt. Mit dieser Strategie legten die Antidemokraten ein Schleifwerkzeug an den demokratischen Diskurs an.
Als einen weiteren Aspekt führte er an die größere Bedeutung von Gefühlen anstelle von Argumenten in den sozialen Medien. Für den Journalismus formulierte Hohlfeld die Aufgabe, nicht ungewichtet jeder Perspektive Geltung zu verschaffen. Wenn jemand behaupte, die Erde sei eine Scheibe, dann dürfe die Überschrift eben nicht lauten: Diskussion über die Form der Erde.
Aus seiner Forschungsarbeit berichtete Hohlfeld über den Zusammenhang von Nachrichten und das Vertrauen in deren Wahrheitsgehalt. Je häufiger Medienkonsumenten eine Information wahrgenommen hätten, desto mehr glaubten sie an deren Wahrheitsgehalt. Gehen also Fake News viral, wächst ihre Glaubwürdigkeit. Hier gelte das alte Sprichwort: Steter Tropfen höhlt den Stein. Auf die Frage von Moderatorin Nina Mülhens, wie sich der Journalismus ändern müsse, formulierte van Rinsum das zeitökonomische Problem, dass dieser inzwischen auch alle Kommunikationskanäle bedienen müsse. Bei dem Druck, in die Breite zu gehen, bleibe dann manchmal die Recherche in die Tiefe auf der Strecke.
So transparent wie möglich arbeiten
Als ein mögliches Geschäftsmodell in näherer Zukunft sah er an, die Überprüfung von Fakten darauf spezialisierten Agenturen zu übergeben. Als Handlungsempfehlung für das schwieriger gewordenen Umfeld gab Hohlfeld den Gästen, so transparent wie möglich zu arbeiten. Sowohl für die PR als auch für den Journalismus sei die Einordnung von Fakten von großer Bedeutung, damit die Menschen eine Orientierung hätten. „Bislang haben wir gesagt: Nachrichten sind Commodity, Kommentar und Einordnung sind journalistischer Value. Heute brauchen wir drei: Commodity ist alles, was durchs Web schwirrt, Value sind verifizierte Informationen, aufbereitet von Profis, Kommentar und Einordnung sind Double Value“, merkte Matthias Dezes abschließend an.
Für die meisten Gäste ging das Podiumsgespräch viel zu schnell zu Ende, aber es gab anschließend bei einem Umtrunk auf Einladung der DPRG noch die Möglichkeit, die vielen Themen des Abends zu vertiefen. Bemerkenswert hoch war die Anwesenheit: 38 Gäste waren gekommen, gut 40 hatten sich angemeldet. In den sozialen Medien, vor allem auf LinkedIn, fand die Veranstaltung im Nachhinein große Resonanz.
Wer die Veranstaltung verpasst hat oder sie noch einmal ansehen will, kann dies auf dem Youtube-Kanal des Frankfurter Presseclub tun.
Foto v.l.n.r.: Nina Mühlens (FPC), Hemut van Rinsum, Prof. Ralf Hohlfeld, Matthias Dezes (DPRG)
Weitere Themen
Landesgruppe
Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland
Die Drei-Länder-Gruppe Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland – auch HRPS genannt – vernetzt Kolleginnen und Kollegen aus Finanzwirtschaft, Verbänden und NGOs ebenso, wie aus Industrie, Handwerk und Verwaltung. Kommunikatoren aus Unternehmen und Agenturen machen den größten Anteil der Mitglieder aus. Das Herzstück unserer Verbandsarbeit sehen wir darin, eine aktive Plattform für den Austausch in der Branche zu schaffen. Dies geschieht durch Besuche bei Unternehmen und Redaktionen, in Workshops und gesellschaftlichen Veranstaltungen. Spezielle Angebote richten sich auch an die Junioren. Die Veranstaltungen laden sowohl zur Wissensmehrung als auch zum Netzwerken ein.
Kontakt: hessen_rheinlandpfalz_saar(at)dprg.de
Ansprechpartner:innen

Vorsitzende
Alexandra Rößler
Alexandra Rößler

Vorsitzender
Sascha Stoltenow
Sascha Stoltenow

Stv. Vorsitzender
Nils Wettengel
Nils Wettengel
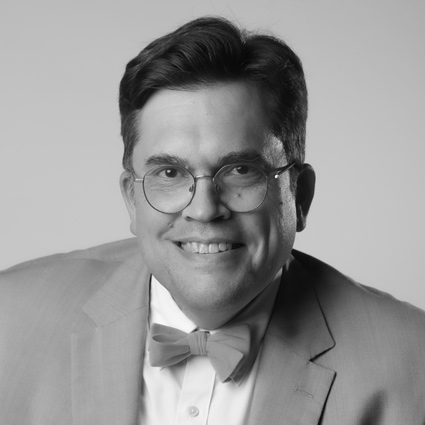
Beisitzer
Dr. Ralf Grünke
Dr. Ralf Grünke
Hauptausschuss:
Manuela Seubert, Sabine Möhring, Thomas Zecher, Peter Höbel













